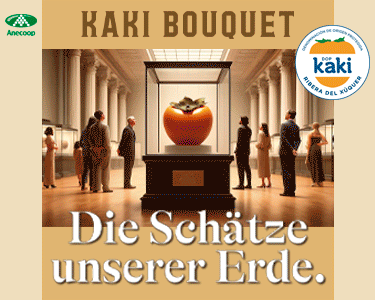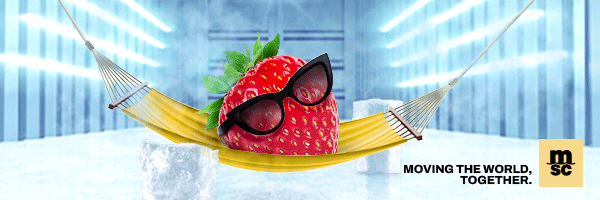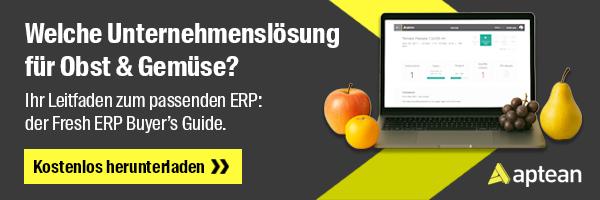Das Konzept könnte die Lebensmittelproduktion verändern und sie nachhaltiger und widerstandsfähiger machen. In einer Vorstudie konnte nachgewiesen werden, dass diese kleinen Tomaten auch ohne Pflanze weiterwachsen können, so die Universität Utrecht. Den Forschern zufolge sollte es auch möglich sein, Tomaten von Anfang an ohne Pflanze anzubauen.
Der Prozess des pflanzenlosen Obstanbaus beginne mit etwas sehr Kleinem: einem Samen oder einem Stück Blatt. Wenn es den richtigen Signalen ausgesetzt wird, die die für die Blüte verantwortlichen Gene aktivieren, entwickelt sich das Ausgangsmaterial zu einer Blütenknospe. Wie in der Natur kann die Blüte bestäubt oder in diesem Fall künstlich zur Fruchtentwicklung angeregt werden. Anstatt Energie aus Sonnenlicht zu beziehen, wächst die pflanzenfreie Frucht in einer kohlenhydratreichen Nährlösung.
„Wenn wir Früchte in Fabriken statt auf Feldern produzieren können, könnten wir einen Teil unserer Nahrungsmittelversorgung vor den Auswirkungen des Klimawandels schützen“, sagt Lucas van der Zee, Doktorand in der Gruppe Gartenbau und Produktphysiologie an der Wageningen University & Research. „Das würde auch bedeuten, dass wir viel weniger Land für den Anbau von Nahrungsmitteln benötigen.“
Während einzelne Schritte des Prozesses bereits zuvor in der wissenschaftlichen Literatur beschrieben wurden, führen die Autoren diese nun erstmals in einem einzigen theoretischen Rahmen zusammen. An der Universität Utrecht arbeitet der Biologe Niels Peeters an dem entscheidenden Schritt, bei dem sich das Ausgangsmaterial von einer Zelle zu einer Blütenknospe entwickelt. In Wageningen untersuchen Forscher, wie sich eine Blütenknospe zu einer reifen Frucht entwickelt.
Kleine Früchte, große Fragen
Die Forscher seien optimistisch, was die Möglichkeiten angehe, betonen jedoch, dass sich das Konzept noch in einem frühen Stadium befindet. Die ersten auf diese Weise angebauten Früchte seien noch klein, und die Produktion sei noch lange nicht nachhaltig. Wenn gewöhnlicher Zucker zur Ernährung der Früchte verwendet wird, wird der Umweltnutzen durch die zusätzliche Anbaufläche, die für die Produktion dieses Zuckers benötigt wird, wieder aufgehoben.
Eine mögliche Lösung sei die Verwendung von aus CO₂ gewonnenem Acetat, einer Verbindung, die mit Essigsäure verwandt ist. Dabei wird CO₂ unter Anwendung von elektrischem Strom mit Wasser zur Reaktion gebracht. Mitautor Robert Jinkerson von der University of California untersucht bereits, wie Pflanzen Acetat für ihr Wachstum nutzen können.
Gesellschaftliche und ethische Entscheidungen
Neben technischen Fragen werfen die Forscher auch soziale und ethische Fragen auf. „Früchte sind mehr als nur ein Konsumprodukt. Wie wir Lebensmittel herstellen, essen und teilen, trägt dazu bei, zu definieren, wer wir sind“, sagt Van der Zee. „Wir glauben, dass es wichtig ist, dass die Menschen mitbestimmen können, wie ihre Lebensmittel produziert werden.“ Zusammen mit der Philosophin und Co-Autorin Zoë Robaey von der Wageningen University & Research, die sich mit der Ethik der Biotechnologie in der Landwirtschaft befasst, untersucht das Team auch Fragen rund um Eigentumsrechte, Zugang zu Technologie und die Rolle von Landwirten und Züchtern.
Van der Zee: „Wir möchten das von uns entwickelte Wissen frei zugänglich machen, damit Menschen auf der ganzen Welt mitbestimmen können, wie kultivierte Früchte aussehen und schmecken sollen.“