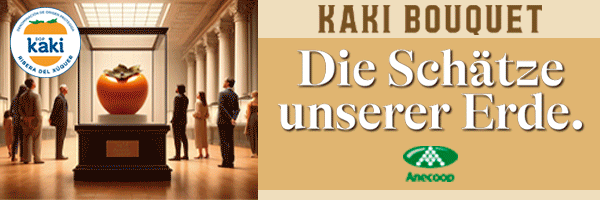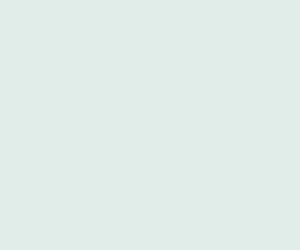Schweiz: Wie schützen wir unser Saatgut in der Zukunft?
Saatgut ist die Grundlage unserer Ernährung. Ohne gesundes Saatgut gibt es keine Lebensmittel und keine Versorgungssicherheit. Samen wurden bisher oft gebeizt, um sie zu schützen. Alternativen zu chemischen Mitteln sind Mikroorganismen oder mechanische Behandlung, teilt der Landwirtschaftliche Informationsdienst (LID) in einem Beitrag mit.

Einem Samenkorn können verschiedenen Hindernisse in den Weg kommen. Es muss genügend Energie gespeichert haben, damit es eine Wurzel entwickeln und seine Keimblätter aus der Erde ans Sonnenlicht treiben kann.
Die Bodenbearbeitung ist ein sehr wichtiger erster Faktor, der die Keimung beeinflusst. Zudem können im Boden oder ausserhalb Krankheiten lauern, die dem Keimling schaden. Wie zum Beispiel Krähen, die sie fressen.
Chemische Beizmittel fallen weg
Um das Saatgut zu schützen, wird es oft gebeizt. Das bedeutet, dass die Samen vor der Aussaat mit einer Flüssigkeit behandelt werden, die sie schützt und ihre Keimfähigkeit verbessert. In der konventionellen Landwirtschaft werden oft chemische Beizmittel verwendet. Wie die meisten Pflanzenschutzmittel sind auch die Beizmittel immer mehr unter Druck. Bestehende Wirkstoffe werden nicht wieder zugelassen und neue Wirkstoffe brauchen lange, bis sie den Zulassungsprozess bestehen.
Das bedeutet für die Landwirtinnen und Landwirte, dass sie ihre Kulturen immer weniger gut schützen können vor Schädlingen und Krankheiten. Die Auswirkung davon sind schlechtere Ernten und somit auch weniger Lebensmittel.
Derweil tüftelt die Branche der Saatgutproduzentinnen und -produzenten an Alternativen zu der chemischen Beizung. An der Fachtagung von Swiss Seed, der Schweizer Vereinigung für Samenhandel und Sortenschutz, an der Hochschule für Agrar- Forst- und Lebensmittelwissenschaften HAFL in Zollikofen gaben verschiedene Referenten und Referentinnen einen Einblick.
Mikroorganismen haben positive Wirkungen
So forscht Hans-Jakob Schärer und sein Team vom Forschungsinstitut für Biolandbau FiBL seit einigen Jahren an Mikroorganismen für die Saatgutbehandlung. Mikroorganismen können verschiedenes bewirken, je nach Art: Verbesserte Verfügbarkeit von Nährstoffen, Kontrolle von Krankheiten – einige Mikroben produzieren Antibiotika, Wachstumsförderung, Kontrolle von Schädlingen, Unkrautkontrolle oder auch verbesserte Stresstoleranz. Doch, so vielversprechend die Wirkungen der Mikroorganismen für den Schutz des Saatgutes sind, so hindernisreich ist der Weg, bis eine praktizierbare Lösung für die Landwirtinnen und Landwirte auf dem Tisch liegt.
Zulassungsverfahren sind langwierig
Ein Hindernis ist die geringe Überlebensrate der Mikroben auf dem Saatgut. Aber auch die Regulatorik ist ein Grund, dass nur sehr wenige Produkte auf dem Markt sind für die Saatgutbeizung. In der Schweiz dauert die Zulassung von Pflanzenschutzmitteln fünf Jahre. Eine Vorreiterrolle in diesem Bereich ist Brasilien. Dort sind schon sehr viele mikrobielle Beizmittel im Einsatz.
Bei Mikroorganismen welche als Biostimulantien, also Dünger, zur Zulassung eingereicht werden, ist das Verfahren einfacher. Auch Mikroorganismenpräparate sind viel mehr auf dem Markt. „Insgesamt haben Mikroorganismen als Saatgutbehandlungen viel Potenzial, das erst teilweise oder noch wenig genutzt wird“, sagte Hans-Jakob Schärer an der Fachtagung.
Mechanisches Verfahren: Dämpfen
Ein anderer Weg, das Saatgut zu schützen ist die mechanische Behandlung. Amadeus Zschunke, der Geschäftsführer von Sativa erklärt die Verfahren. Sativa ist eine Firma, die Biosaatgut produziert, für den Biolandbau und Gartenbau. „Die Behandlung des Saatgutes ist erst notwendig, wenn trotz den Präventionsmassnahmen in der Zucht, Probleme wie Krankheiten auftreten“, stellte Amadeus Zschunke klar.
Die mechanische Saatgutbehandlung reduziert samenübertragbare Krankheiten unter ein Schadschwellenniveau. Beispiele dafür sind Pilze wie Stinkbrand an Weizen oder Möhrenschwärze, Bakterien wie Blattflecken an Möhren oder auch Viren wie das Gurkenmosaikvirus bei Gurken, Melonen oder Zucchini. In der mechanischen Behandlung sind verschieden Verfahren möglich.
Warmwasser: Saatgut waschen in warmem Wasser von 45 bis 53°C für 5 bis 30 Sekunden. Dies ist sehr wirksam gegen verschiedene Erreger aber nur für kleinere Mengen wie beim Gemüsesaatgut gut geeignet. Die Methode ist Zeit- und Energieaufwändig. Eine Rücktrocknung ist erforderlich.
Heißdampf: Wenn Warmwasser nicht geht wie bspw. bei Basilikum, Rucola oder Kresse, dann wird Saatgut zuerst befeuchtet und dann erhitzt. Der Wasserdampf tötet die Pilzsporen ab. Diese Methode nutzt auch das Fenaco Unternehmen ‚UFA-Samen‘ mit der sog. Thermosem-Anlage. Sie behandelt 15 t Getreide pro Stunde. Diese Methode ist weniger energieaufwändig und hat eine höhere Leistung.
Mechanische Verfahren: Trockene Hitze, Elektronenbeize oder Bürsten
Auch Sativa nutzt das Heissdampfverfahren mit Temperaturen bis 75°C während 30 bis 360 Sekunden. Hier werden Samen von Basilikum, Rucola, Kresse, Kohlarten, Karotten, Randen, Gurkengewächsen, Dill, Petersilie und mehr behandelt.
Trockene Hitze: Temperatur 70°C bis 90°C, 1 Stunde bis 3 Tage. Virus wird inaktiviert. Hier muss das Saatgut sehr trocken sein und langsam abkühlen können. Sativa nutzt dies bei Gurkenarten, Tomaten und Paprika.
Elekronenbeize: Die Oberfläche der Samen wird mittels Strom, genauer Elektronen, desinfiziert. Der ionisierende Effekt wirkt gegen Pilze, Bakterien, Viren und äussere Schadinsekten. Diese Methode ist im Biolandbau nicht erlaubt.
Bürsten: Einsatz bei Getreidesaatgut mit Stinkbrandsporen zur Reduktion. Dies zeigt eine ausreichende Wirkung bei schwachem bis mittlerem Befall, gemäss Amadeus Zschunke von Sativa.
Die Grenzen der mechanischen Behandlung
Wenn Erreger unter der Samenschale oder nah am Embryo beziehungsweise sogar im Embryo sitzen, ist die Behandlung des Saatgutes mit mechanischen Methoden unsicher. Die Keimfähigkeit der Samen leidet. Außerdem sind die Kosten der Verfahren und deren Wirtschaftlichkeit limitierende Faktoren für den breiten Einsatz. „In Zukunft reichte es nicht mehr nur Symptome zu bekämpfen können – wir müssen die Systeme besser verstehen lernen“, so Amadeus Zschunke abschließend.
Praxistaugliche Lösungen für die Landwirte und Landwirtinnen
Andreas Keiser, Professor für Ackerbau und Pflanzenzüchtung von der HAFL, sagte: „Es wird in Zukunft nicht eine Lösung geben, wie wir das Saatgut schützen können, sondern eine Kombination von Massnahmen.“ „Das Ziel der Entwicklung muss sein, den Landwirtinnen und Landwirten vernünftige und wirksame Lösungen anzubieten – Forschung ist nicht ihre Aufgabe, sondern die der Forschenden“, sagte Jürg Jost, Geschäftsführer von Swiss Seed. Monika Joss von der Firma Corteva Agriscience, die neue chemische Beizmittel entwickelt, sagt in Bezug auf die Zulassungssituation: „Es geht darum, dass Landwirtinnen und Landwirte in der Schweiz die gleichen Chancen und Wettbewerbsbedingungen haben wie ihre Berufskollegeninnen und -kollegen in den Nachbarländern.“